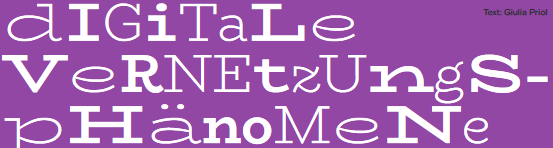Wie verändern sich soziale Phänomene durch die Digitalisierung unserer Kommunikation? Giulia Priol, studentisches Redaktionsmitglied, hat sich bei ihren Recherchen und Überlegungen einer Frage gewidmet, die in einem fortlaufenden und komplexen Transformations- und Innovationsprozess nicht abschließend beantwortet werden kann. Jedoch zeigt der vergleichende Blick auf einige ausgewählte Phänomene im Zeitverlauf – wie Proteste, Fankulturen oder E-Mail-Kommunikation – wie wir uns selbst und die Gesellschaften, in denen wir leben, durch die Möglichkeiten der Digitalisierung verändern.
Protest
Stimmt es, dass wir in einer Zeit nie dagewesener Massenprotestbewegungen leben? Nie zuvor haben sich so viele Menschen auf die Straßen begeben, um zu protestieren. Eine Erklärung, die häufig als Grund dafür herangezogen wird, ist, dass die digitale Vernetzung über das Internet, soziale Medien und Messenger-Dienste die Mobilisierung von Menschen vereinfacht hat. Wirft man jedoch einen Blick in die Vergangenheit, lassen sich auch hier massive Protestbewegungen mit hohen Zahlen von Teilnehmenden finden, denen die heutigen Vernetzungshilfsmittel der Digitalisierung nicht zur Verfügung standen. Wie also hat sich unser Protestverhalten durch die Digitalisierung verändert?
Obwohl im Jahr 2020 das öffentliche Leben weitgehend von einer Pandemie lahmgelegt worden war, begaben sich in den USA Millionen Menschen auf die Straße, um gegen Polizeigewalt und Rassismus zu protestieren. Der Auslöser war ein Video vom 26. Mai 2020, das die Ermordung des Afroamerikaners George Floyds durch einen weißen Polizisten zeigt, und das sich über soziale Medien rasend schnell verbreitete. Im Juli des gleichen Jahres schrieb die New York Times, dass Black Lives Matter die größte Protestbewegung in der Geschichte der USA sein könnte. Zwischen 15 und 26 Millionen Menschen, so die Schätzungen, sollen auf den Straßen gewesen sein.¹ Schon in den Jahren zuvor fanden sich große Menschenmassen zum Protest zusammen. So beispielsweise im September 2019: Damals traf sich Greta Thunberg, die Initiatorin der Fridays-for-Future-Bewegung, mit dem kanadischen Premierminister Justin Trudeau in Montreal. Anschließend versammelten sich auf den Straßen der Stadt 500.000 Menschen – und wurden gleichzeitig von vielen Menschen in anderen Städten weltweit unterstützt – nicht nur dort, sondern auch in vielen anderen Städten weltweit.²
Wirft man jedoch einen Blick in die Vergangenheit, lassen sich auch hier Beispiele für Protestbewegungen mit sehr hohen Teilnehmendenzahlen finden: Im Zuge des Civil Rights Movements oder des Vietnamkrieges zog es in den USA der 1960er und 1970er Jahre immer wieder mehrere hunderttausend Menschen auf die Straßen. Auch in Deutschland fanden bei den Ostermärschen in den 1960er Jahren oder aufgrund des Nato-Doppelbeschlusses 1979 Proteste mit bis zu 500.000 Menschen statt, wie der Historiker Dieter Rucht beschreibt – und zwar ganz ohne Internet oder Social Media.³
Damals seien es oft kleinere Gruppen gewesen, die diese Proteste organisierten – und in denen einzelne Personen als Gesicht der Bewegung dienten, sagt Guiomar Rovira-Sancho, die als Kommunikationsforscherin an der Universidad Autónoma Metropolitana in Mexiko-Stadt lehrt. Sie erforscht, wie sich Protestbewegungen über die Jahre hinweg verändert und entwickelt haben, und erzählt davon in unserem Interview. Der Organisationsaufwand für Protestaktionen, sagt sie, sei damals größer gewesen – die einzelnen Protestbewegungen dafür in der Regel langlebiger. Was sich seit Beginn der Digitalisierung beobachten ließe, sei eine zunehmende Individualisierung der Aktivist*innen. Man gehöre heute als Protestierende*r in der Regel nicht mehr einer bestimmten ideologischen Gruppierung, Partei oder Organisation an, sagt sie. Stattdessen gingen vielfältige und gut vernetzte Gruppen gemeinsam auf die Straße.
»
Auf die Straße
zu gehen, um
zu protestieren,
ist unumgänglich.
«
Dass mehr Menschen über das Internet mobilisiert werden können, scheint erstmal auf der Hand zu liegen: Jede*r ist jederzeit erreichbar, Informationen lassen sich schneller in Umlauf bringen und das Zusammenfinden in Gruppen Gleichgesinnter oder zumindest im Protestzusammenhang ähnlich Denkender ist einfacher. Die Politikwissenschaftlerin Anita Breuer vom Deutschen Institut für Entwicklungspolitik betont zudem, dass soziale Medien in vielen Ländern mit restriktiven Regimen schnell zur einzigen Möglichkeit wurden, um überhaupt Protestbewegungen ins Rollen zu bringen und sich über die politische Zensur der Medien als Informationskanäle hinwegzusetzen. So war es beispielsweise 2010 beim Arabischen Frühling, bei den Protesten am Gezi-Park in der Türkei 2013 oder denen gegen die Pekingnahe Regierung in Hongkong seit 2019. Hingegen hätten die Sozialen Medien auf das Protestverhalten in westlichen Kulturen lange einen relativ geringen Effekt gehabt.⁴
Doch genau das hat sich in den vergangenen Jahren geändert, seit auch in den westlichen Kulturen immer mehr Menschen über Twitter, Instagram und Facebook an politischen Debatten teilnehmen und ihre Meinung äußern. Dabei ist vor allem auch die Zahl der Menschen, die zum Beispiel durch Liken, das Hochladen eines für eine Protestbewegung genutzten Profilbildes oder durch das Teilen von Inhalten an eine Protestbewegung An-schluss nehmen, massiv angestiegen. Doch da diese Protestbekundungen oftmals nicht über digitalen Unmutsäußerungen hinausgehen, werden diese Formen des Online-Aktivismus häufig als sogenannter Clicktivism kritisiert. Und auch der ehemalige US-Präsident Barack Obama sprach sich in einem Interview während des Obama Foundation Gipfels 2019 dagegen aus, den physischen Protest durch Online-Aktivismus zu ersetzen.⁵
Diesen vorschnell als unnütz abzustempeln, sagt Rovira-Sancho in unserem Gespräch, sei jedoch eine übereilte Reaktion. Hashtags zum Beispiel seien keine Protestbewegungen per se. Ihre Verwendung bewirkten jedoch direkte Handlungen und Reaktionen im Internet, die physischen Protestaktionen häufig vorausgehen würden. Und hinter einem Hashtag, so Rovira-Sancho, stecke oft noch wesentlich mehr: Hashtags würden Missstände und Probleme für viele Menschen unter einem Begriff vereinen – und könnten, bei wiederholtem Auftreten, schnell wieder in Umlauf gebracht werden. Dadurch würde die spontane Organisation von Protestaktionen vereinfacht und wiederum eine Dauerhaftigkeit ermöglicht. Das Interessante sei, so Rovira-Sancho, dass jede Online-Protestaktion und -kampagne dabei unterschiedlich und doch gleich sei und sich oft global wiederfinden lasse. Insofern ist Online-Aktivismus für sie eines der nützlichsten Werkzeuge, um eine weltweite Konversation zu starten. Trotzdem betont die Kommunikationswissenschaftlerin: „Auf die Straße zu gehen, um zu protestieren, ist unumgänglich. Denn das ist der Begegnungsort, an dem wir nicht nur Schatten im Internet sind, sondern uns als Menschen verletzlich machen.“ Hier zeige sich erst das physische Ausmaß des Protests hinter den Stimmen im Netz. Gleichzeitig hätten wir heute viele neue Möglichkeiten, an Protestaktionen mitzuwirken, die uns erst durch die digitale Vernetzung überhaupt ermöglicht worden seien. „Das“, sagt sie abschließend, „ist weder gut noch schlecht. Es ist der Ist-Zustand – und den müssen wir bestmöglich nutzen.“
1
2
3
4
5
Larry Buchanan/Quoctrung Bui/Jugal K. Patel: „Black Lives Matter May Be the Largest Movement in U.S. History“. In: New York Times (3. Juli 2020)
nytimes.com/interactive/2020/07/03/us/george-floyd-protests-crowd-size.html
Greta Thunberg leads 500,000 people at Montreal climate rally“. In: Deutsche Welle (27. September 2019)
dw.com/en/gretathunberg-leads-500000-people-at-montrealclimate-rally/a-50617527
Dieter Rucht: „Protestbewegungen“. In: Wolfgang Benz (Hg.): Die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Band 3: Gesellschaft. Frankfurt/M.: Fischer: Taschenbuch Verlag 1989, S. 311-344
econstor.eu/bitstream/10419/112163/1/208465.pdf
Anita Breuer: „The Role of Social Media in Mobilizing Political Protest“, Discussion Paper, Deutsches Institut für Entwicklungspolitik, Bonn (2012)
die-gdi.de/uploads/media/DP_10.2012.pdf
„Barack Obama takes on ‚woke‘ call-outculture: ‚That’s not activism‘“. In: The Guardian (30. Oktober 2019)
youtube.com/watch?v=qaHLd8de6nM
Das ganze Interview mit Guiomar Rovira-Sancho findet sich auf unserer Homepage wittenlab.de
Mehr Informationen zu ihrer Arbeit:
uam-xochimilco.academia.edu/GuiomarRoviraSancho
E-Mail-Kommunikation
In diesem Jahr feiert ein technologisches Phänomen, das unsere Kommunikation von Grund auf revolutioniert hat, seinen runden Geburtstag: Die E-Mail wird 50 Jahre alt.¹³ Insbesondere unser Arbeitsalltag ist ohne sie heute nicht mehr denkbar. Die Tendenz ist steigend: Allein in Deutschland waren es im vergangenen Jahr 848 Milliarden E-Mails – zehn Jahre zuvor lediglich 217 Milliarden. Eine Zeit, in der Sender und Empfänger sich nicht innerhalb weniger Sekunden austauschen konnten, ist gerade für jüngere Generationen heute nicht mehr vorstellbar. Die Zusammenarbeit muss damals doch schleppend langsam und ineffzient gewesen sein – oder etwa nicht?
Um diese Frage zu beantworten, reicht ein Blick über den großen Teich, in die USA, genauer gesagt: nach Virginia. Durch das dort in den 1960er Jahren erbaute Hauptquartier der Central Intelligence Agency zieht sich noch heute ein 50 Kilometer langes, aus Stahlröhren konstruiertes, pneumatisches Kommunikationssystem. In kleinen Kapseln wurden hier zu Höchstzeiten bis zu 7500 Nachrichten pro Tag mit rund 35 Stundenkilometer zwischen den einzelnen Abteilungen verschickt. Zweimal am Tag wurden diese dann sortiert und verteilt. Was man bis in die 80er Jahre hinter diesen Mauern hätte beobachten können – würde es sich nicht um einen Geheimdienst handeln – war ein klassisches Beispiel von asynchroner Kommunikation: dem zeitlich verzögerten Prozess von Nachricht und Antwort. Mit der Erfindung der E-Mail wurden solche Systeme, die zudem lokal begrenzt waren, überflüssig. Der Abstand zwischen Nachricht und Antwort hat sich seither technologisch immer weiter verringert – und ist mittlerweile nahezu synchron. Und was sich gleichzeitig verkürzt hat, ist die Zeit, in der wir erwarten, eine Antwort zu bekommen.
Die häufigste Reaktionszeit auf die rund 100 Milliarden täglich weltweit verschickten E-Mails liegt heute bei 2 Minuten. Bei vielen nimmt die Bearbeitung und Beantwortung beruflicher Emails mehr als 3 Stunden am Tag in Anspruch – zählt man private dazu, lassen sich noch einmal zwei Stunden hinzuaddieren. Neben zusätzlichen Telefon- und Videokonferenzen, Meetings oder Unterhaltungen mit Kolleg*innen – ebenfalls Formen der synchronen Kommunikation –, bleibt kaum Zeit, sich über einen längeren Zeitraum auf eine Aufgabe zu konzentrieren. Kurz: Die Frequenz und Geschwindigkeit, die in heutigen Kontaktwegen an den Tag gelegt wird, hat nur noch wenig mit der asynchronen Kommunikation zu tun, die vor einigen Jahrzehnten der Standard war. Doch was ist dadurch mit unserer Aufmerksamkeitsfähigkeit geschehen?
Am Institut für Informatik der University of California in Irvine befasst sich Gloria Mark, Professorin für Computer Supported Co-operative Work mit genau dieser Frage. Ihren Forschungsergebnissen nach, kontrollieren Menschen ihr E-Mail-Postfach im Durchschnitt rund 70 Mal am Tag – wobei einige diese Zahl sogar bis um das Sechsfache in die Höhe treiben. Wird man durch Klingeltöne oder Push-Nachrichten über den Eingang neuer Nachrichten informiert, lenkt das jedes Mal von dem Arbeitsprozess ab, in dem man sich gerade befunden hat. Laut Mark und Kolleg*innen widmet man sich nach einer solchen Unterbrechung nicht einfach wieder der unterbrochenen Tätigkeit, sondern braucht mehrere Minuten, um in die vorausgegangenen Denkprozesse zurückzufinden – wenn man dabei nicht von der nächsten Mitteilung unterbrochen wird.²
Unsere Aufmerksamkeitsspanne, so die Wissenschaftlerin, hat sich deutlich verkürzt. Und das, was gerne als Multi-Tasking bezeichnet wird, schadet unserer Kreativität und verringert unsere Arbeitsqualität. Denn diese lebt davon, dass wir uns über einen längeren Zeitraum einer einzigen Sache widmen.³ In Kombination mit Facebook, Twitter und Co., die unsere Aufmerksamkeitsspanne zusätzlich verkürzen, lag die konzentrierte Aufmerksamkeitsspanne von Proband*innen – die Zeit, bevor sie den Impuls bekommen, sich abzulenken – 2004 noch bei durchschnittlich 3 Minuten. Heute hat sich dieser Wert auf 40 Sekunden reduziert.
Diese regelmäßigen Unterbrechungen führen statt zu erhöhter Produktivität eher zu einem kontraproduktiven Ergebnis. Und im Ergebnis stehen wir vor der Entwicklung einer neuen De-Synchronisierung unserer Kommunikation: Denn je mehr Nachrichten bei Menschen mit immer geringerer Aufmerksamkeitsspanne eintreffen, desto eher entsteht Überforderung. Die Beantwortung der Nachrichten wird aufgeschoben oder ausgesetzt. Die Folgen sind Stress und Frustration.⁴ Unter diesen Umständen wäre es nicht verwunderlich, wenn vielleicht manch eine*r in den vier Wänden der CIA nostalgisch an das pneumatische Kapselsystem der 1960er Jahre zurückdenkt, bei dem man auch getrost am nächsten Tag antworten konnte.
1
2
3
4
Joel Khalili: „Email is 50 years old, but there’s life in the old dog yet“. In: Techradar (24. März 2021)
techradar.com/news/email-is-50-years-old-but-theres-life-in-the-old-dog-yet
Gloria Mark/Victor M. Gonzalez/Justin Harris: „No Task Left Behind? Examining the Nature of Fragmented Work“. In: CHI 2005
ics.uci.edu/~gmark/CHI2005.pdf
Sophie Leroy/Theresa M. Glomb: „A Plan for Managing (Constant) Interruptions at Work“. In: Harvard Business Review 06 (2020)
hbr.org/2020/06/a-plan-for-managing-constant-interruptions-at-work
Gloria Mark/Daniela Gudith/Ulrich Klocke: „The Cost of Interrupted Work: More Speed and Stress“. In: CHI 2008
ics.uci.edu/~gmark/chi08-mark.pdf
Fankulturen
Die Liebe zur Musik einer Band hat Menschen früher wie heute verbunden. Das zeigt die „Beatlemania“, wohl eines der bislang weitreichendsten Phänomene in Sachen Fankultur. Weit vor Beginn der digitalen Vernetzung brachten John, Paul, Ringo und George aus Manchester nach ihrem raketenhaften Aufstieg in den 1960er Jahren bis dato unvergleichliche Menschenmengen bei ihren Konzerten und Auftritten zusammen. Dabei sorgten sie für einen derartigen Aufruhr, dass sie sich schließlich entschieden, zu einer reinen Studioband zu werden. Ihre Anhänger organisierten sich schon damals in Fanclubs, die alle verfügbaren Informationen über ihre Idole sammelten, Newsletter verteilten und Fanmagazine erstellten. Neue Informationen und Fernsehmeldungen gab es jedoch nur sporadisch und häppchenweise. Eine Art der Interaktion, die heute zwischen weltbekannten Künstler*innen und deren Fans undenkbar wäre.
Vielleicht gibt es sie ja noch, diejenigen, an denen der Begriff K-Pop weitestgehend vorbeigegangen ist – oder jene, die dabei nur an den Erfolgssong „Gangnam Style“ des südkoreanischen Musikers PSY denken, mit ulkigem Tanzstil und buntem Video. Dieses Genre ist jedoch in den letzten Jahren zu einem globalen Massenphänomen geworden, mit Bands wie Blackpink oder BTS, die aktuell überall, wo sie auftreten, für Ausnahmezustände sorgen. BTS setzt sich aus 7 Mitgliedern zusammen – RM, J-Hope, Jin, Jimin, Suga, V und Jungkook – und ist die derzeit erfolgreichste Boyband der Welt. Sie brechen reihenweise Rekorde: Als erste Band seit den Beatles haben sie vier Nummer eins Alben in einem Jahr veröffentlicht. Ihr erster englischsprachiger Song „Dynamite“ erreichte innerhalb der ersten 24 Stunden nach Veröffentlichung den Rekord von 100 Millionen Klicks auf YouTube (mittlerweile sind es mehr als 1,1 Milliarden). Ein Höchstwert, den sie ein knappes Jahr später mit ihrer zweiten englischsprachigen Single „Butter“ erneut gebrochen haben – was ihnen als erster südkoreanischer Band eine Grammy-Nominierung einbrachte. Ihre Erfolge schreibt die Gruppe maßgeblich ihrer außerordentlich gut vernetzten und engagierten Fanbase zu, der sie den Namen Army (Adorable Representative M.C. for Youth) gegeben haben.
Abgesehen von der Hingabe der Fans und der Reichweite ihres Erfolges lassen sich BTS und die Beatles wohl eher weniger miteinander vergleichen. Interessant ist jedoch, wie sich die Vernetzung der Fans untereinander und mit ihren Idolen verändert hat. Fanclubs wie in Beatles-Zeiten gibt es nicht mehr. Dafür gut strukturierte und organisierte Fanseiten, die kontinuierlich Bilder, Neuigkeiten und Videos über Bands wie BTS verbreiten – und über die Künstler*innen selbst mit ihren Fans kommunizieren. Gerade das K-Pop-Business hat die Möglichkeiten der direkten digitalen Vernetzung der Fans mit ihren Idolen erkannt und legte darauf von Anfang an den Fokus. Jugendliche werden gecastet und als Trainees über mehrere Jahre zu sogenannten Idols ausgebildet – und vernetzen sich bereits vor ihrem Debut mit ihren Fans. Während das Musiklable der Beatles nur ein monatlich erscheinendes Magazin herausbrachte, tritt BTS heute täglich über Instagram und Twitter, Clipreihen auf YouTube oder durch eine eigene App mit ihrer Fanbase in Kontakt. Die Army ist untereinander außerordentlich gut vernetzt und reagiert innerhalb von kürzester Zeit auf sämtliche Impulse, die mit ihren Idolen in Zusammenhang stehen. Seit dem Debüt der Band ist die Zahl der BTS-Fans in den dreistelligen Millionenbereich gestiegen – und weist mittlerweile eine enorme kommerzielle und politische Mobilisationskraft auf. Produkte, die beispielsweise in Videos und Bildern, die die Idols veröffentlichen, erwähnt werden, sind innerhalb von Stunden auf sämtlichen Plattformen in mehreren Ländern ausverkauft. Auch stellen sich die Mitglieder der Army zunehmend kollektiv hinter politische Kampagnen oder bringen Millionenspenden zusammen. Dass mit dieser Fangemeinde nicht zu spaßen ist, musste unlängst auch ein bayrischer Regionalsender erfahren, der sich innerhalb weniger Stunden, nachdem ein Moderator sich despektierlich über BTS geäußert hatte, einem globalen Shitstorm ausgeliefert sah.
Die Leidenschaft und Hysterie der Fans, die einst dazu geführt hatten, dass sich die Beatles zu einer reinen Studioband entwickelten, wird heute von BTS und ihrem Label gezielt und kontrolliert genutzt. Den bis dato beispiellosen Rückhalt und Organisationsgrad der Fanbase bringt Bandleader RM selbst treffend in der neuen Single „Butter“ auf den Punkt: „Got Army right behind us when we say so“.
Die Beständigkeit und bedingungslose Treue der Fans existiert sich bereits seit dem Debut der Band im Jahr 2013 – und hat ihrem Musiklabel Big Hit Entertainment Ende 2020 einen erfolgreichen Börsengang ermöglicht. Mittlerweile ist der wirtschaftliche Erfolg der Gruppe auch dem südkoreanischen Staat ein Anliegen. Kein Wunder: BTS ist, neben SAMSUNG und Hyundai, zu einer der größten Einkommensquellen des Landes geworden. Die Band erwirtschaftete 2019 4,65 Millarden Dollar. Und für eine*n von 13 Tourist*innen ist sie der Grund, nach Südkorea zu reisen. Nun hat der südkoreanische Staat ein Gesetz verabschiedet, dass es den Mitgliedern der Band ermöglicht, den verpflichtenden Wehrdienst auch nach ihrem 30. Lebensjahr zu absolvieren, um ihre Karriere weiter voranzubringen. Eine noch nie dagewesene Ausnahme. Und neben der Beatlemania gibt es mittlerweile einen zweiten Begriff, der die Manie um eine Band beschreibt: den „BTS-Effekt“.
1
2
Paulina Sajnach: „The Korean Wave: From PSY to BTS –The Impact of K-Pop on the South Korean Economy“. In: Asia Scotland Institute (22. Januar 2021)
asiascot.com/news/2021/01/22/the-korean-wave-from-psy-to-bts-the-impact-of-k-pop-on-the-south-korean-economy
Katarina Buchholz: „How Much Money Does BTS Make for South Korea?“. In: Statista (5. November 2019)
statista.com/chart/19854/companies-bts-share-of-south-korea-gdp
GIULIA PRIOL
Giulia Priol studiert im 5 Semester Philosophie, Politik und Ökonomik an der UW/H. Sie ist Mitglied des Redaktionsteams des WITTEN LAB Magazins.